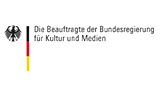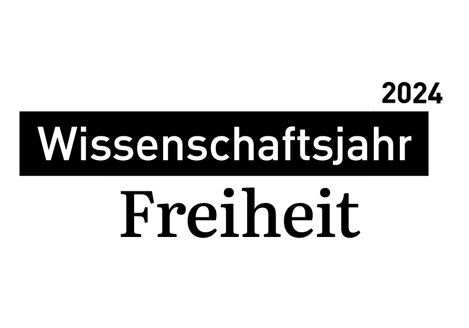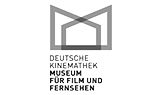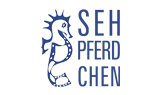Digitale Begleitmaterialien zu "Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit" von Yulia Lokshina

Die SchulKinoWochen Niedersachsen realisierten mit Vision Kino digitale Begleitmaterialien zum Dokumentarfilm "Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit":
"Einführung durch Eva-Maria Schneider-Reuter", 4:25 min. und
"Eva-Maria Schneider-Reuter im Gespräch mit Regisseurin Yulia Lokshina", 21:30 min.
Redaktion: Dorothee Maack & Jörg Witte, Produktion: Vision Kino, Kamera und Ton: Robert Paul Kothe, Schnitt: Bernd Wolter. Aufgenommen im Kino Krokodil, Berlin, Dezember 2020.
Oben ein Screenshot aus dem Gespräch zwischen Eva-Maria Schneider-Reuter und Yulia Lokshina (links).
Die Medienpädagogin Christina Nur schreibt zu beiden Videos:
Filmgespräche in eigener Geschwindigkeit.
Einführung in den Film und Gespräch mit Yulia Lokshina zu ihrem Dokumentarfilm "Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit" als Stream für die SchulKinoWochen
Nicht nur Kino, sondern auch die bei vielen Veranstaltungen angesetzten Filmgespräche müssen in diesen Zeiten neu gedacht werden. Wenn die FilmemacherInnen für ein anschließendes Gespräch nicht ins Kino zu den Zuschauern kommen können, müssen andere Lösungen gefunden werden. Die SchulKinoWochen haben dies ausprobiert und exemplarisch einige FilmemacherInnen zu ihren Filmen interviewt, um diese Interviews als pädagogisches Begleitmaterial zur Verfügung zu stellen.
Am Beispiel des Interviews mit Yulia Lokshina zu ihrem Film "Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit" (2020) lassen sich Potentiale dieser digitalen Form der Filmvermittlung aufzeigen.
Ein vertrautes Gefühl von Kinoatmosphäre stellt sich ein, was daran liegt, dass die Einführung in den Film mit der Moderatorin Eva-Maria Schneider-Reuter in einem Kinosaal aufgezeichnet worden ist. Wie bei einer Kinoveranstaltung fühlt man sich begrüßt und eingestimmt auf den folgenden Film, zu dem kurz Hintergrundinformationen und Produktionsbedingungen genannt werden. Gleichzeitig gibt die Anmoderation Beobachtungsaufgaben und Impulse für die Filmsichtung an die Hand. Wenn zum Beispiel die Frage aufgeworfen wird wie Yulia Lokshina den Zuschauer in den Film einführt, welcher Erzählebenen sich der Film bedient oder mit welcher Schlussszene dieser endet, werden von Beginn an Begleitfragen an die Filmsichtung gestellt. Für Schulen und Lehrkräfte bietet diese Aufbereitung nicht nur eine Entlastung, sondern auch viel Diskussionspotential im Vorfeld auf den Film.
Nach der Sichtung des Dokumentarfilmes kann das Interview mit der Filmemacherin Yulia Lokshina per Stream angeschaut werden. Auch hier moderiert wieder Eva-Maria Schneider-Reuter und nimmt ihr Publikum souverän und einfühlsam mit. In knapp 22 Minuten erhält man einen Einblick über Produktionsbedingungen und erfährt viele Hintergrundinformationen zu dem Film und der Herangehensweise Lokshinas ans Filmemachen, wie sie Geschichten erzählen will, was für sie Dokumentarfilm ausmacht und was ihre Intentionen der Filmgestaltung gewesen sind.
Die Themen und Thesen des Filmes wie Leiharbeit, Arbeitsmigration und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie weisen eine beängstigende Aktualität auf, was zu Beginn der Recherche und der Dreharbeiten medial so nicht abzusehen war. Umso vorausschauender wirkt Lokshinas Film in diesen Zeiten und wird hoffentlich über die SchulKinoWochen ein breites junges Publikum finden.
Im Interview wird auch die Frage nach der künstlerischen Entscheidung der Schlussszene aufgeschlüsselt oder über die Chronologie der Dreharbeiten berichtet. Alles Hintergrundinformationen, die zur Verdichtung des Filmes führen und die Filmrezeption bereichern können.
Aufschlussreich auch die Aussagen von Lokshina zum Titel ihres Filmes. Entgegen der hohen Geschwindigkeit setzt der Film einen Kontrapunkt und bedient diese Geschwindigkeit nicht, sondern "lässt Szenen bewusst länger stehen und atmen." Was verstehen Jugendliche unter einem Regelwerk, wo im gesellschaftlichen Leben werden sie damit konfrontiert? Lokshina wirft durch ihre Fragestellungen Auseinandersetzungen weit über ihre Filmthematik hinaus auf, die fächerübergreifend in Schule stattfinden können. Gerade Interpretationen von Filmtiteln im schulischen Kontext bieten vor Sichtung eines Filmes einen assoziativen Einstieg in die Filmanalyse. Als weitere Methodik bietet es sich an, die Fragen der Moderation zuerst von den SchülerInnen beantworten zu lassen, um diese dann später mit den Antworten der Filmemacherin abzugleichen. Hierdurch entsteht eine besondere Aneignung des filmischen Materials.
Spannend für Jugendliche auch die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen, die in Lokshinas Dokumentarfilm für das Brechtstück "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" proben. Diese Szenen sind sicher nicht nur für SchülerInnen des Darstellenden Spiels interessant.
Bezeichnend, dass Lokshina auch hier auf das Zeigen des Endergebnisses in Form einer Theaterinszenierung verzichtet, sondern vor allem den künstlerischen Prozess der Theaterproben und Auseinandersetzungen der jungen Menschen mit den Brechtschen Motiven in den Vordergrund stellt. In der filmischen Beobachtung dieser komplexen Prozesse, in denen sich junge Menschen eine eigene Haltung erarbeiten, schafft Lokshina die von ihr gewünschten Denkräume. Ihre Intention, den Zuschauer ernst zu nehmen, indem "keine konkreten Handlungsweisen gegeben werden, sondern an die Eigenverantwortlichkeit der Zuschauer, eigene Gedanken zu formulieren und Zusammenhänge herzustellen", verfolgt der Film stringent und bringt dadurch einen Dialog mit dem Publikum zutage, der nicht entmündigt, sondern zu eigener Haltung verhilft. Wenn Filmbildung dies bewirken kann, vermittelt sie wichtige Schlüsselkompetenzen.
Große Vorteile in den auf Abruf verfügbaren Filmgesprächen liegen darin, dass Inhalte vertieft werden können, indem die Möglichkeit besteht, an bestimmten Stellen im Interview innezuhalten, zurückzuspulen und durch das mehrmalige Schauen auch Verständnisschwierigkeiten klären zu können. In diesem nonlinearen Schauen liegt ein großer Mehrwert vor allem für den Einsatz in Schule. Unabhängig von zeitlichen, räumlichen und personellen Ressourcen kann immer wieder auf einzelne Textbausteine Bezug genommen werden, was der vertiefenden Analyse sehr dienlich ist.
Die SchulKinoWochen beschreiten mit aufgezeichneten Filminterviews in Pandemiezeiten einen Weg, der in einer immer stärker digitalisierten Welt zukunftsweisend ist.
Ergänzend zu Filminterviews ließe sich auch ein Making Of anbringen, um den künstlerischen Prozess des Filmemachens noch näher zu bringen. Die sprachliche Ebene ließe sich zudem auch noch mit Schnittbildern aus dem Film oder von den Dreharbeiten visuell aufbereiten, um die Inhalte für SchülerInnen noch anschaulicher zu gestalten. Die Filmgespräche sind nicht nur für Schülergruppen interessant, sondern werden sicher auch bei Filmhochschulen und in anderen wissenschaftlichen Kontexten Anklang finden.
Ersetzen kann dies die persönliche Begegnung mit Filmemachern nicht, aber ergänzen beziehungsweise durch die Filmrezeption begleiten allemal. Fehlen tut allerdings die Möglichkeit, noch eigene individuelle Fragen an den Schaffensprozess zu stellen oder in eine Interaktion mit den FilmemacherInnen zu kommen. Hier ließen sich Überlegungen eines Blogs oder einer Chatfunktion andenken.
Nach dem Filmgespräch mit Yulia Lokshina möchte man ihren Film am liebsten abermals anschauen, um diesmal mit den vielen Hintergrundinformationen neue Perspektiven und Lesarten zu entdecken.
Christina Nur